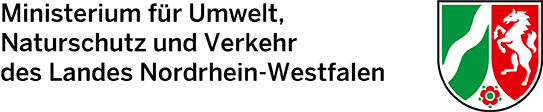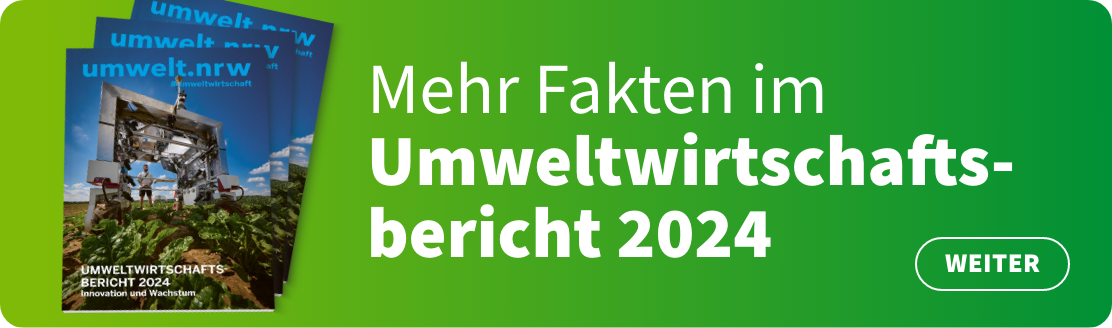Der Strukturwandel des Rheinischen Reviers strebt eine EU-weit beispielgebende Kombination von ökonomischer Prosperität mit einer strategisch-nachhaltigen Raumentwicklung an. Die Umweltwirtschaft liefert vielfältige Ansätze und Lösungen für die Umsetzung dieser Jahrhundertaufgabe. Die einmalige Kombination zwischen Innovationen, Wertschöpfung und nachhaltigem Wirtschaften macht die Umweltwirtschaft zur zentralen Schlüsselbranche. Mit neuen Ideen dient sie als Motor einer nachhaltigen Transformation. Die Unterstützung der Umweltwirtschaft in der Region hilft im Prozess des Strukturwandels somit doppelt: Die Querschnittsbranche schafft neue Arbeitsplätze und treibt gleichzeitig den nachhaltigen Wandel voran.
Im Rheinischen Revier waren im Jahr 2023 rund 74.000 Erwerbstätige in den Teilmärkten der Umweltwirtschaft beschäftigt (Wachstum 2010–2023: 1,1 % p. a.) und erwirtschafteten eine jährliche Wertschöpfung von mehr als 6,5 Mrd. Euro (Wachstum 2010–2023: 3,9 % p. a.). Betrachtet man das Rheinische Revier als eine zusammengehörige Wirtschaftsregion, so bildet diese – etwa gleichauf mit der Region Ostwestfalen-Lippe – nach der Metropole Ruhr und der Region Köln/Bonn den drittgrößten Standort der Umweltwirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Seit Jahren dominiert der Teilmarkt Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft die Umweltwirtschaft der Region in den Kennzahlen Erwerbstätigkeit und Bruttowertschöpfung. Die Umweltfreundliche Mobilität besticht ebenfalls durch eine hohe Erwerbstätigenzahl, der Teilmarkt Energieeffizienz und Energieeinsparung erwirtschaftet die zweithöchste Bruttowertschöpfung. Das stärkste Wachstum aller Marktsegmente innerhalb der regionalen Umweltwirtschaft lässt sich mit 8,2 % p. a. der Erwerbstätigkeit und 12,1 % p. a. der Bruttowertschöpfung bei den Intelligenten Energiesystemen und Netzen beobachten, angetrieben v. a. durch das Marktsegment Netzausbau und -betrieb. Die meisten Patente werden im Rheinischen Revier in den Teilmärkten Umweltfreundliche Energiewandlung, -transport und -speicherung sowie Energieeffizienz und Energieeinsparung angemeldet. Aufgrund des Sonderstatus der Region werden hier die Innovationskompetenzen aus verschiedenen Wirtschaftsregionen vereint.
Der Strukturwandel allgemein, aber im Besonderen in der von Tagebauen geprägten Landschaft des Rheinischen Reviers, betrifft nahezu alle Bereiche von Ökonomie, Gesellschaft und Umwelt. In der Projektlandschaft des Rheinischen Reviers, die über verschiedene Förderaufrufe initiiert wurde, stehen zahlreiche Projekte in einer sehr engen Beziehung zur Umweltwirtschaft und den dort strukturierenden Wendethemen (Klimawende, Ressourcenwende und Raumwende). Im Zuge der vielfältigen Förderaufrufe hat die Landesregierung in enger Abstimmung mit der Region im März 2024 insgesamt 19 Ankerprojekte für eine beschleunigte und erfolgreiche Umsetzung des Strukturwandels im Rheinischen Revier identifiziert. So ist beispielsweise das Ziel des „Gigawattpakts“, die Stromerzeugungskapazitäten aus den Erneuerbaren bis 2028 auf mindestens 5 Gigawatt zu erhöhen. Mit der „Modellfabrik Papier“ entsteht in Düren wiederum ein Forschungszentrum für ein bundesweites Innovationsnetzwerk zur nachhaltigen Papierproduktion mit dem Ziel, den Energiebedarf in der Papier- produktion bis 2045 um ca. 80 % zu reduzieren. Auch die Thematik der biobasierten Kreislaufwirtschaft wird in verschiedenen Ankerprojekten aufgegriffen und vertieft. So fokussiert das BioökonomieREVIER, in dessen Rahmen im Forschungszentrum Jülich in 14 Innovationslaboren geforscht wird, auf die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Produkte sowie die Rückführung von Ressourcen in Kreisläufen. Mit der „Textilfabrik 7.0“ soll in Mönchengladbach der Textilindustriepark der Zukunft geschaffen werden, CO₂-neutral, basierend auf Kreislaufwirtschaft und unterstützt durch Biotechnologie, Robotik und Künstliche Intelligenz, um so Teile der wegfallenden Wertschöpfung und Beschäftigung im Rheinischen Revier aufzufangen.
Für die Transformation zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft auf dem Weg zu Netto-Nullemissionen von Treibhausgasen und der Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum bietet die Umweltwirtschaft somit vielfältige Chancen. Die Lösungen der Umweltwirtschaft wirken dabei besonders in der Kombination mit langfristig strukturbildenden Infrastrukturen. Entscheidend wird es sein, die Umsetzung der Projekte in einer sich wandelnden Landschaft zu fokussieren – ab 2030 beginnt die Flutung der ehemaligen Tagebau- bzw. Restseen – und neue Standortund Lebens-Qualitäten zu schaffen. Neben den jeweiligen Projektakteuren sind es dabei die Tagebauumfeld-Initiativen mit ihrer direkten Verbindung in die Kommunen, die in der Umsetzung entscheidende Bedeutung haben.